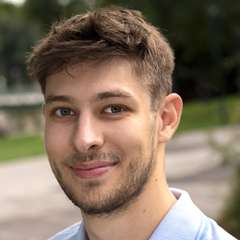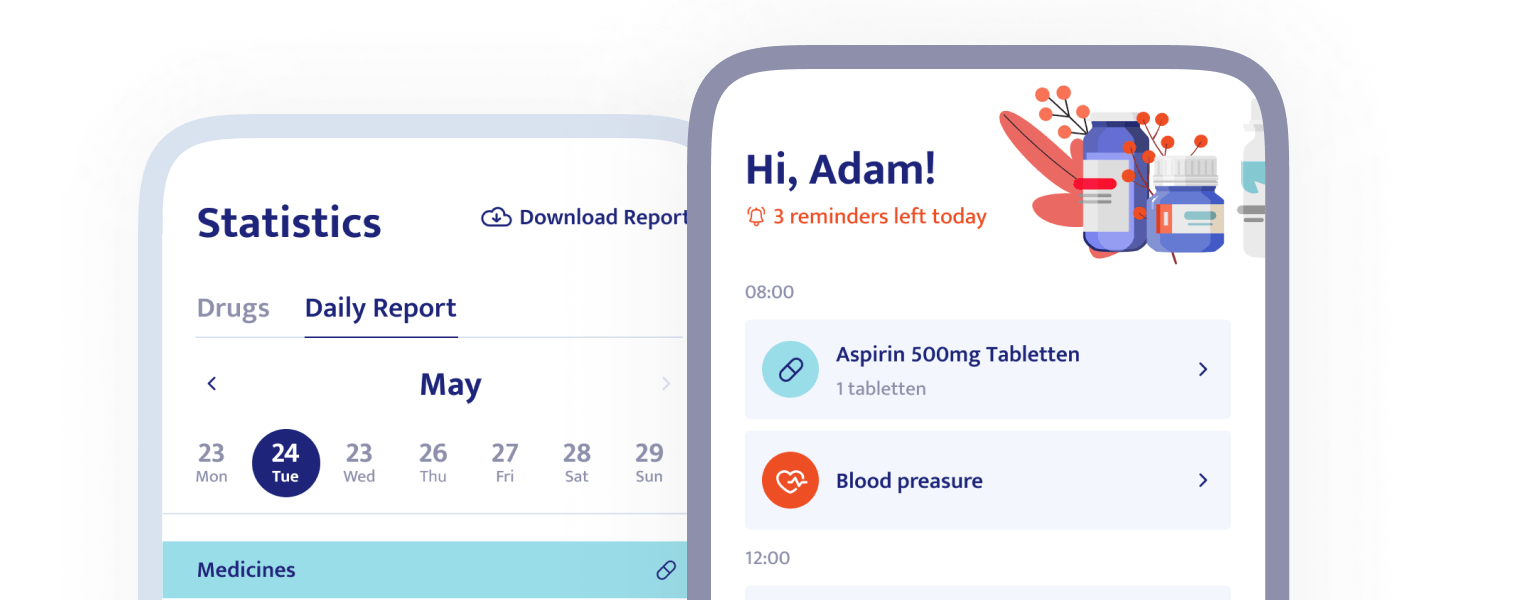Grundlagen
Ranolazin ist ein Medikament, das zur Behandlung von Brustschmerzen im Zusammenhang mit dem Herzen eingesetzt wird.
Anwendung und Indikationen
Ranolazin ist für die Behandlung der chronischen Angina pectoris angezeigt. Es kann allein oder in Verbindung mit Nitraten, Betablockern, Angiotensin-Rezeptorblockern, Thrombozytenaggregationshemmern, Kalziumkanalblockern, Lipidsenkern und ACE-Hemmern eingesetzt werden. Meist wird es jedoch als Zusatzbehandlung eingesetzt, wenn die bisherige Therapie nicht ausreichend ist.
Ranolazin wurde auch außerhalb der Zulassung („Off-Label“) zur Behandlung bestimmter Herzrhythmusstörungen, einschließlich ventrikulärer Tachykardien, eingesetzt. Diese Verwendung ist jedoch wissenschaftlich nicht hinreichend belegt. Ranolazin wurde auch zur Behandlung des akuten Koronarsyndroms, der mikrovaskulären koronaren Dysfunktion, von Herzrhythmusstörungen und zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels untersucht, wobei diese Indikationen noch nicht zugelassen sind.
Ranolazin wird in Form von Retardtabletten (Tabletten mit verzögerter Wirkstofffreisetzung) verabreicht und ist in den Dosierungen 375 mg, 500 mg und 750 mg erhältlich. Anfangs werden meist 2-mal täglich 375 mg verabreicht. Diese Dosierung kann dann langsam gesteigert werden. Bei Patient:Innen mit einer Leber- oder Nierenschädigung sollte diese Steigerung besonders langsam erfolgen.
Ranolazin ist verschreibungspflichtig und in den USA, der EU und der Schweiz zugelassen.
Geschichte
Ranolazin wurde in den 1980er Jahren von dem mexikanischen Unternehmen Syntex, welches 1994 von Roche übernommen wurde, entwickelt. Die Erstzulassung von Ranolazin erfolgte 2006 in den USA und 2008 in der EU. Die Zulassung in der Schweiz erfolgte schließlich 2010.