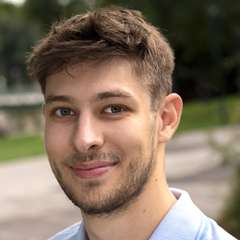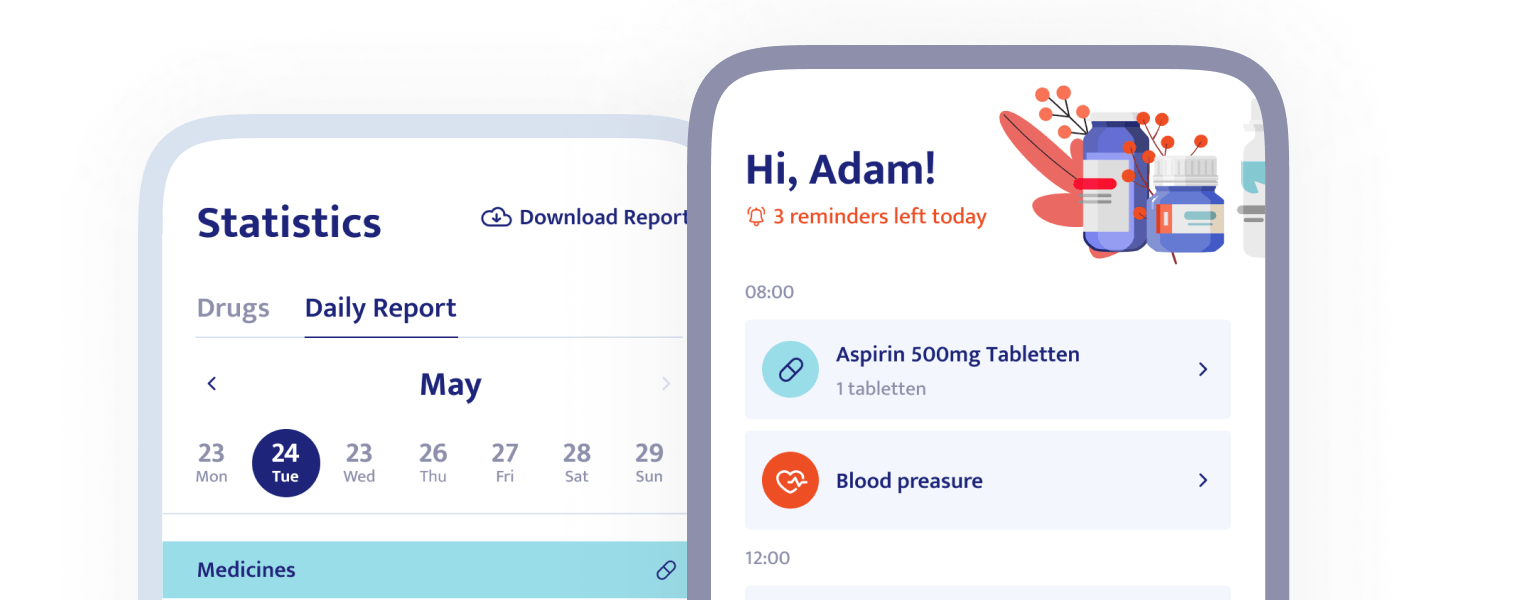Physiologie und Pharmakodynamik
Oxytocin spielt eine wichtige Rolle bei den Wehen und der Geburt. Das Hormon wird im Hypothalamus produziert und vom paraventrikulären Kern an die hintere Hypophyse abgegeben, wo es gespeichert wird. Während der Geburt wird es dann in Schüben freigesetzt, um die Uteruskontraktionen auszulösen.
Oxytocin bindet an Oxytocin-Rezeptoren (OXTR) im Uterusmyometrium, wodurch die G-Protein-gekoppelte Rezeptor-Signaltransduktionskaskade ausgelöst wird, die zu erhöhten intrazellulären Calciumkonzentrationen führt. Erhöhte Calciumkonzentrationen aktivieren die Myosin-Leichtkettenkinase, die wiederum das kontraktilen Proteins Aktomyosin beeinflusst. Dies stimuliert unter anderem die Kontraktionen der glatten Muskulatur der Gebärmutter. Oxytocin stimuliert auch die glatte Muskulatur in den Brustdrüsen und führt so zur Laktation. Die Dichte von Oxytocinrezeptoren auf dem Myometrium (Muskelschicht der Gebärmutterwand) nimmt während der Schwangerschaft deutlich zu und erreicht in den frühen Wehen einen Höhepunkt, wodurch der Effekt von Oxytocin in dieser Zeit besonders stark ist.
Oxytocin ist eines der wenigen Hormone im Körper, das durch positive Rückkopplung und nicht durch negative Rückkopplung reguliert wird. Wird beispielsweise durch den Kopf des Fötus Druck auf den Gebärmutterhals ausgeübt, bewirkt das die Freisetzung von mehr Oxytocin aus dem Hypophysenhinterlappen. Das vermehrt ausgeschüttete Oxytocin wandert dann zum Uterus, wo es die Uteruskontraktionen stimuliert und weiter verstärkt. Die ausgelösten Uteruskontraktionen stimulieren dann wiederum die Freisetzung zunehmender Mengen von Oxytocin. Diese positive Rückkopplungsschleife setzt sich bis zur Geburt des Kindes fort.
Da exogen verabreichtes und endogen ausgeschüttetes Oxytocin die gleichen Wirkungen auf das weibliche Reproduktionssystem haben, kann synthetisches Oxytocin in bestimmten Fällen während der Geburtsvorbereitung und nach der Geburt eingesetzt werden, um Uteruskontraktionen auszulösen oder zu verstärken.
Pharmakokinetik
Oxytocin wird als intravenöse Infusion oder intramuskuläre Injektion verabreicht. Die Wirkung tritt schnell ein, in der Regel innerhalb weniger Minuten. Die Dauer der Wirkung hängt von der Dosis und individuellen Faktoren ab. Oxytocin wird in der Leber abgebaut und über den Urin ausgeschieden. Das Enzym Oxytocinase ist maßgeblich für den Stoffwechsel und die Regulation des Oxytocinspiegels während der Schwangerschaft verantwortlich.
Wechselwirkungen
- Prostaglandine können die Wirkung von Oxytocin verstärken, da sie zu einer Sensibilisierung der Muskelschicht der Gebärmutterwand für Oxytocin führen. Ein Abstand von 6 Stunden zwischen der Verabreichung von Prostaglandinen und Oxytocin sollte eingehalten werden.
- Arzneimittel, die gleichzeitig das QT-Intervall verlängern, sollte nicht mit Oxytocin kombiniert werden
- Methylergometrin verstärkt die kontrahierende Wirkung von Oxytocin
- Blutdrucksteigernde Sympathomimetika und Oxytocin verursachen zusammen einen verlängerten Druckanstieg
- Die Wirkung von Antihypertonika kann unter Oxytocin gesteigert sein
- Halothan-Narkosen und Oxytocin können einen besonders starken Blutdruckabfall auslösen