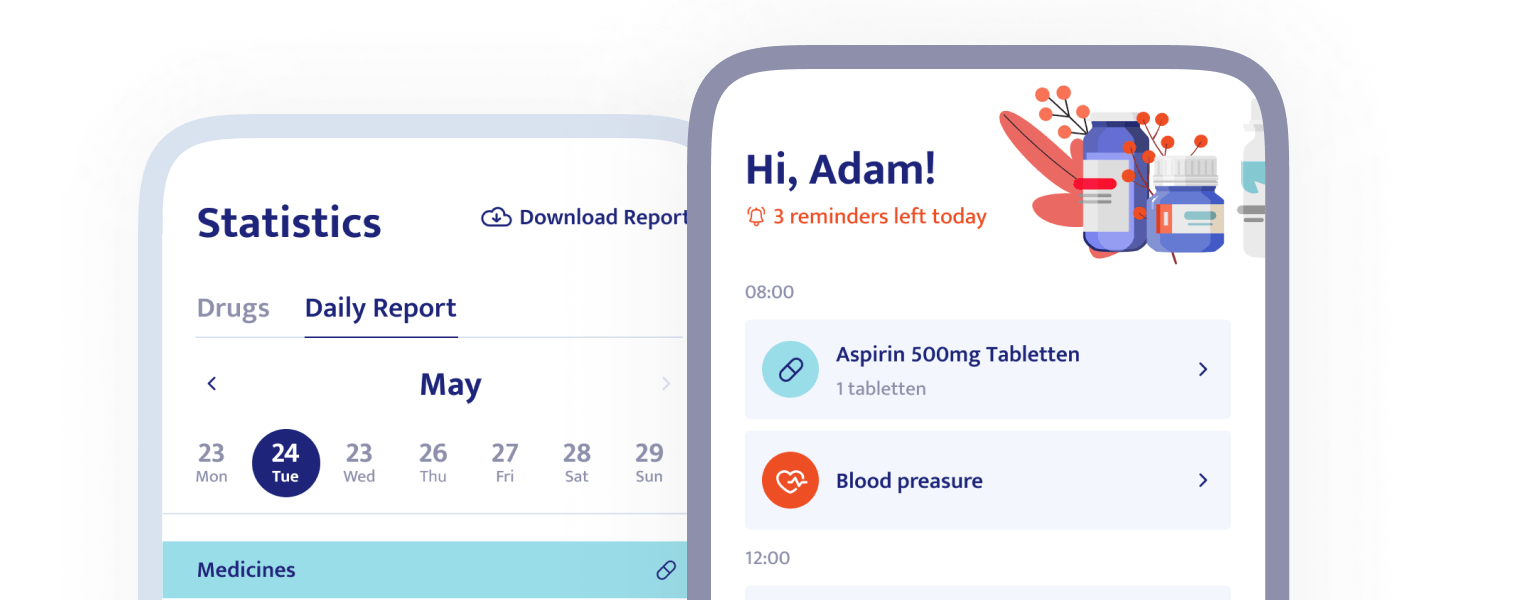Chirurgische Eingriffe kommen nur in seltenen Fällen bei Verstopfungssymptomen zur Anwendung. Wird die Verstopfung durch Opioide ausgelöst, ist ein Therapieversuch mit peripher wirkenden Opioidantagonisten (PAMORA) empfehlenswert.
Die Indikation zur Therapie ist meist vom Leidensdruck der Betroffenen abhängig. Tritt die Verstopfung sekundär, etwa im Zuge einer Erkrankung wie Divertikulitis, Morbus Crohn oder Hämorrhoiden auf, muss in erster Linie die Krankheit behandelt werden.
Allgemeinmaßnahmen bei chronischer Obstipation:
Maßnahme | Evidenzgrad |
Aufklärung über die Stuhlfrequenz | Empfohlen |
Zeit für Toilettenbesuch | Empfohlen |
Frühstücken | Empfohlen |
Ausreichende Flüssigkeitszufuhr | Empfohlen |
Flüssigkeitszufuhr weiter steigern | Nicht empfohlen |
Körperliche Aktivität steigern | Möglicherweise wirksam |
Probebehandlung mit Ballaststoffen | Empfohlen |
Ernährung
Durch ein Frühstück wird die motorische Aktivität des Dickdarms stark gesteigert. Auch nach dem Aufstehen arbeitet der Dickdarm vermehrt, sodass ein Frühstück mit einem darauf folgenden Toilettenbesuch empfehlenswert ist. Eine Steigerung der normalen Trinkmenge über 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit hat keine zusätzliche therapeutische Wirkung auf eine Verstopfung. Besteht jedoch ein Flüssigkeitsdefizit, sollte dieses ausgeglichen werden.
Vor einer Therapie mit Abführmitteln sollte eine Gabe von Ballaststoffen getestet werden. Gehen die Beschwerden danach zurück, erübrigt sich auch die weiterführende Diagnostik. Nahrungsmittel, die das Stuhlvolumen steigern, sind etwa Vollkornprodukte, Weizenkleie oder Flohsamenschalen. Obst, Gemüse und vor allem Salate enthalten demgegenüber weniger wirksame Ballaststoffe. Spezielle Obstsorten (z. B. Trockenpflaumen) enthalten jedoch oft eine große Menge an Sorbit, das an sich abführend wirkt. Milchzucker (Laktose) in Form von Milch oder auch als Pulver wirkt bei einer Überschreitung der Darmkapazität für die Laktoseaufnahme ebenfalls abführend.
Therapie der Beckenbodendyssynergie
Gelingt es durch diverse Ernährungsmaßnahmen das Stuhlvolumen zu steigern, so entfällt auch das Pressen beziehungsweise die paradoxe Kontraktion des Schließmuskels. Die „Bedienungsstörung” kann auch abtrainiert werden, indem den Betroffenen die Sphinkterfunktion erklärt wird, und das Pressen mit Relaxation des Schließmuskels bei digitaler Palpation geübt wird. Noch wirksamer ist das sogenannte „Biofeedbacktraining” sein, das mit speziellen Geräten zu Hause durchgeführt wird.
Abführmittel (Laxantien)
Die Dosis und die Frequenz der meisten Abführmittel richten sich nach den Bedürfnissen der Betroffenen. Ziel ist immer ein weicher und geformter Stuhl, der ohne starkes Pressen entleert werden kann. Eine Begrenzung der Einnahmedauer ist oftmals unbegründet. Wird ein Wirkstoff schlecht vertragen oder erzielt er keine ausreichende Wirkung, sollte er auf eine andere Wirkstoffklasse gewechselt werden. Neu entwickelte Substanzen sind dabei alten Wirkstoffen nicht überlegen. Gegebenenfalls kann auch eine Kombination aus Präparaten unterschiedlicher Klassen Erfolg bringen.
Orale Abführmittel
Der Begriff salinische Laxantien bezeichnet Magnesiumhydroxid, Glaubersalz, Bittersalz und Karlsbader Salz. Diese Salze können vom Körper schlecht aufgenommen (resorbiert) werden und sind daher osmotisch wirksam. Wegen ihres gewöhnungsbedürftigen Geschmacks sind sie, mit Ausnahme von Magnesiumhydroxid, nicht für die Langzeitgabe geeignet. Vorsicht geboten ist bei Patienten mit Herz- oder Niereninsuffizienz, da die Salze bei einer Therapie bis zu einem gewissen Grad vom Körper aufgenommen werden.
Macrogol ist ein synthetischer, bakteriell nicht spaltbarer Ballaststoff mit einem hohen Molekulargewicht (3350–4000). Er bindet bei der Anwendung Wasser und führt so zu einer abführenden Wirkung. Da Macrogol nicht gespalten werden kann, führt es im Darm zu keiner Gasbildung. Ein Elektrolytzusatz zu Macrogol bietet keine Vorteile, verschlechtert den Geschmack und damit auch die Akzeptanz von Betroffenen jedoch stark. Die empfohlene Tagesdosis beträgt etwa 10 - 30 g.
Dünndarmenzyme können Disaccharide und Zuckeralkohole nur begrenzt beziehungsweise gar nicht in Monosaccharide spalten, weshalb sie eine abführende Wirkung haben. Für Sorbit ist demgegenüber die Resorptionskapazität im Darm begrenzt. Stoffe wie Laktose oder Lactulose werden jedoch von Dickdarmbakterien weiterverarbeitet, woraufhin sie ihre Wasserbindungsfähigkeit verlieren und somit weniger stark abführend wirken. Vor allem bei einem langsamen Darmtransit kommt es dabei zu einer starken Transformation der Stoffe. Für viele Betroffene ist zudem die Gasbildung beziehungsweise der süße Geschmack (Laktulose) störend. Die Tagesdosis liegt bei 10 bis 30 g.
Das Prokinetikum Prucaloprid wirkt über den 5-HT4-Rezeptor (Serotoninrezeptor), wobei es bei Betroffenen zur Anwendung kommt, die auf andere Maßnahmen nur schlecht reagieren. Die einmal pro Tag eingenommene Dosis beträgt üblicherweise 1–4 g.
Weitere orale Abführmittel sind beispielsweise Bisacodyl, Natrium-Picosulfat oder Anthrachinone.
Nebenwirkungen der oralen Abführmittel
Alle in Europa handelsüblichen Laxantien können als sicher bewertet werden und bei einer korrekten Dosierung auch langfristig eingesetzt werden. Manchmal kann es bei dauerhaftem Gebrauch und erhöhter Dosis zu einem Elektrolytverlust kommen, wobei der Elektrolytverlust bei einer normalen Dosierung nicht zu erwarten ist. Bei einer vernünftigen Dosis tritt auch meist keine Hypokaliämie auf, obwohl vor dieser Nebenwirkung in der Literatur oft gewarnt wird. Einige Betroffene berichten bei oralen Laxantien über einen geringen Gewöhnungseffekt in Bezug auf die abführende Wirkung und wechseln daher ab und an das Präparat beziehungsweise auf eine andere Wirkstoffklasse.
Rektale Therapieoptionen
Ob rektale oder orale Laxantien eingesetzt werden, liegt oftmals an der individuellen Vorliebe von Betroffenen. Rektale Behandlungsmöglichkeiten der Verstopfung umfassen Einläufe, salinische Klysmen und verschiedenste Zäpfchen (z. B. glycerin- oder bisacodylhältig). Die rektalen Therapiemöglichkeiten haben dabei einen kurzen Wirkungseintritt und sind gut steuerbar. Insbesondere können sie bei Defäkationsstörungen gut eingesetzt werden.
Chirurgische Eingriffe
Eine Entfernung des Dickdarms (Kolektomie) mit einer Belassung des Rektums sollte nur bei schweren therapierefraktären Slow-Transit-Obstipationen und/oder bei einem idiopathischem Megacolon angedacht werden. Zuerst müssen auch alle Störungen mit einer verminderten Motilität des Magens und des Dünndarms ausgeschlossen werden.