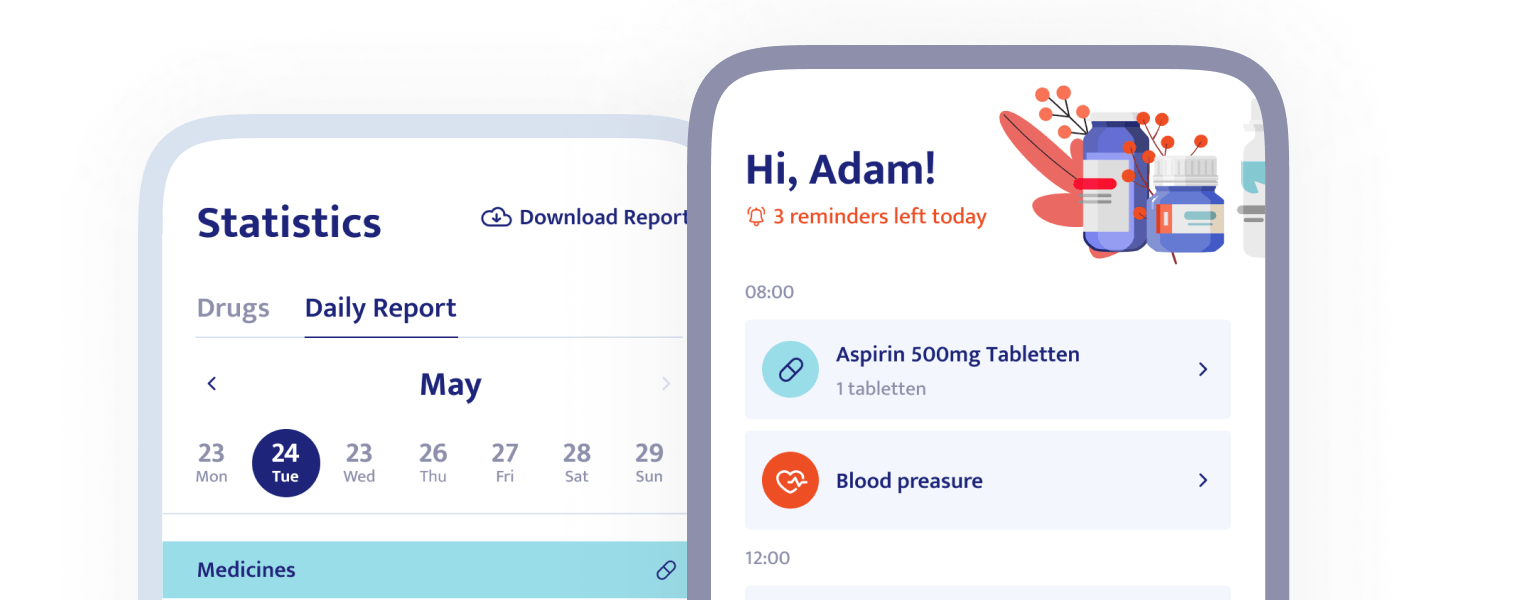Verhaltensmodifikation
Methoden der Lern- und Verhaltenspsychologie eignen sich zur Einübung eines gesunden Essverhaltens und Lebensstils. Beispielsweise können so Trigger für die Nahrungsaufnahme analysiert und erkannt werden. Ungünstige Verhaltensmuster in Bezug auf die Nahrungsaufnahme können mit professioneller psychologischer Hilfe auch oft verändert werden. Es empfiehlt sich, die Nahrungsaufnahme von externen Faktoren abzukoppeln und Regeln für Mahlzeiten sowie für den Lebensmitteleinkauf festzulegen. Auch Gruppeninterventionen eignen sich zur Änderung des Essverhaltens und sind oft erfolgreicher als Einzelsitzungen.
Bewegungstherapie
Bewegung hat neben einem höheren Energieverbrauch auch andere positive Auswirkungen auf den Organismus. Jeder Adipositas-Betroffene sollte daher zu einer Steigerung der regelmäßigen Bewegungsaktivität ermutigt werden. Sport beziehungsweise körperliche Aktivität hat auch den Vorteil, dass die Muskelmasse während einer Diät erhalten bleibt, wodurch sich auch die Langzeitergebnisse einer Gewichtsabnahme verbessern.
Durch Bewegung kann der Kalorienverbrauch des Körpers gesteigert werden. Zudem sinkt der Appetit durch Sport und auch die Stressregulation funktioniert besser. Für viele Menschen sind diverse Sportarten ein stabilisierendes soziales Ereignis, wobei Sport insbesondere einen positiven Effekt auf das Herz-Kreis-Lauf-System hat, welches durch Fettleibigkeit oftmals in Mitleidenschaft gezogen wird. Im Idealfall sollte man mindestens drei- bis fünfmal pro Woche 30 Minuten Sport betreiben. Dabei sollte man auch auf erreichbare Ziele achten, denn es ist besser, regelmäßig weniger zu trainieren, als unregelmäßige Intensivtraining abzuhalten.
Die Art des Sports ist zweitrangig, wobei Ausdauersportarten meist günstiger sind als Kraftssportarten. Da Adipositas-Patienten oftmals untrainiert sind, sollte regelmäßiger Sport erst nach einer ärztlichen Untersuchung durchgeführt werden. Die Belastungsintensität kann danach schrittweise gesteigert werden, wobei eine Überbelastung aufgrund des gesteigerten Verletzungsrisikos bei Adipositas unbedingt vermieden werden sollte.
Medikamentöse Maßnahmen
Medikamente sind immer als Unterstützung zu einer Lebensstilveränderung zu sehen und sollten immer mit dieser kombiniert werden.
Mögliche Wirkstoffe zur Behandlung einer Fettleibigkeit sind:
Wirkstoff | Wirkmechanismus | Häufige Nebenwirkungen |
Orlistat | Lipasehemmer (hemmt die Fettresorption im Darm) | Blähungen, Flatulenzen, Fettstühle |
Liraglutid, Semaglutid | GLP-1-Rezeptor-Agonisten (hemmen den Appetit und verlangsamen die Magenentleerung) | Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Verstopfung |
Naltrexon/Bupropion | Opioidantagonist/Norpinephrin-Dopamin-Reuptake-Hemmer ( Ausschüttung anorexigener Hormone, Hemmung des Belohnungszentrums) | Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Kopfschmerzen, Obstipation, Schlaflosigkeit, Hitzewallungen, Bluthochdruck, Mundtrockenheit, Müdigkeit |
Adipositaschirurgie
Bei Adipositaschirurgischen-Eingriffen müssen Betroffene immer sorgfältig über die Risiken und Folgen eine Eingriffes aufgeklärt werden, da das Operationsrisiko bei bestehender Fettleibigkeit stark erhöht ist.
Die Indikation zur Operation ist meist erst ab einem BMI von über 40 gegeben. Bei einem BMI von über 35 kann eine Operation in Betracht gezogen werden, wenn Begleiterkrankungen eine rasche Gewichtsreduktion notwendig machen oder alle anderen Therapieversuche gescheitert sind.
Grundsätzlich wird bei diesen chirurgischen Eingriffen versucht, das Magenvolumen zur reduzieren. Hierdurch kommt es zu einer limitierten Nahrungszufuhr, die wiederum eine Gewichtsreduktion mit sich bringt.
Zu den verschiedenen Verfahren gehören unter anderem:
- Gastric Banding (Magenband): Ein Silikonband wird um den Magen gelegt und daraufhin je nach Bedarf mit Flüssigkeit gefüllt. Dadurch wird der Eingang zum Magen verkleinert und es können nur kleine Nahrungsmengen aufgenommen werden.
- Vertikale Gastroplastik: Durch Klammernähte wird ein Teil des Magens abgetrennt und durch ein Silikonband gesichert.
- Magenballon: In den Magen wird ein Ballon eingesetzt, der je nach Bedarf mit mehr oder weniger Flüssigkeit gefüllt wird. Diese Methode wird heute nur selten angewandt.
Für eine dauerhafte Senkung des Körpergewichtes sollten jedoch auch die Essgewohnheiten verändert und optimiert werden. Zudem benötigen Betroffene nach einer Operation meist weiterhin eine intensive internistische, ernährungsmedizinische und psychologische Betreuung. Mikronährstoffe wie Vitamine und Spurenelemente müssen nach einem Adipositaschirurgischen-Eingriff oft ergänzt werden.